-
- Oelheim
- (Ölheim)
-
Der Bohrturm „Hunäus“ erinnert daran:
Vom 9. Mai 1862 an wurde bei
Edemissen, unter der Leitung von Professor
Hunäus, die dritte Erdölbohrung in Deutschland niedergebracht. Die Ausbeute war jedoch
wenig ergiebig.
Den Durchbruch erlebte die Erdölförderung am 21. Juli 1881:
Mit dem Turm „Mohr 3“ (siehe Zeichnung) kam man bei 37,5 Metern und 66 Metern auf eine
Sandsteinschicht, bei der das Öl mit gewaltiger Kraft emporschoss. Aus dem Bohrloch sprudelten täglich 75000 Liter Öl. Das war für damalige
Vorstellungen eine sensationell große Menge.
Die Siedlung, in der
Bohrmeister und Hilfskräfte wohnten, nannte man in hoffnungsvoller Erwartung Ölheim.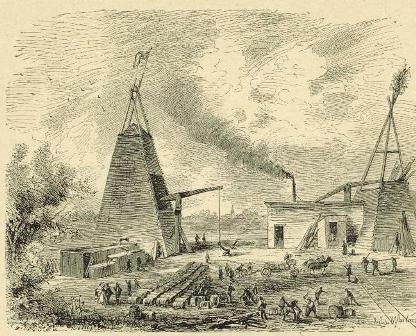
Um 1885 hatte Oelheim bereits 69
Einwohner viele Petroleumbohrwerke mit unzähligen Bohrtürmen, und ein von nah
und fern gut besuchtes Solbad, das Waltersbad (später Solbad Seffers).
Ganz Deutschland verfiel in
einen wahren Ölrausch. Seit 1927 wurden mehr als 200 Bohrungen in diesem Raum
durchgeführt und vier Ölfelder erschlossen.
Die Zeitungen brachten
seitenlange Artikel. Der Berichterstatter der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung
schilderte seine ersten Eindrücke in der Ausgabe vom 05. August 1881 so:
"Zahlreiche Thürme,
aus dünnen Eisenstangen gefügt, ragen hoch empor, daneben stehen
pyramidenförmige Holzbauten. Maschinenschlote senden ihre schwarzen
Rauchwolken zum Himmel, und zwischen niedrigen Holzhäusern, welche theils als
Comptoire und Wohnräume, theils als Schenken dienen, wogt ein geschäftiges
Arbeitervolk in schwarzen, öldurchtränkten Kleidern. Das Ganze macht einen
seltsamen Eindruck hier mitten in der öden Heide, und erinnert lebhaft an die
amerikanischen Petroleumbezirke in Pennsylvanien."
... und so entstand das heutige
Oelheim.


Die
Teerkuhlen
Die
älteste Erwähnung der Teerkuhlen stammt aus dem Jahre 1563/64, aus dem
“Verzeichnisse der in den Ämtern des Fürstenthums Lüneburg befindlichen
Unterthanen“, in dem es unter der Ortschaft “Dolbergen“ heißt:
Halpse
eyne woste Derp unde Wolpse, woste, Hebben de van Abbensen under dem plog,
unde geven dar van den tegenden vorlopt sich by 1 1/2 ses. roggen. Item to
Wolpse sin de vette Kulen.
Das
heißt:
Halpse
und Wolpse sind wüste Dörfer. Die Äcker haben Abbensener Bauern zur
Bestellung übernommen. Bei Wolpse befinden sich die Fettkuhlen. Davon
wird ein Pfund abgefischt.
Es
besteht jedoch die Möglichkeit, dass schon Georgius
Agricola
Aliquod
non nihil est caeruleum: quale interdum non longe a Brunonsis vico
invenitur.
Das
heißt:
Es
gibt dort eine Menge Blaues, das bisweilen nicht fern von Brunonsis
gefunden wird. (Erdölvorkommen nicht weit von Braunschweig).
Ab
1579, also 39 Jahre vor Ausbruch des 30jährigen Krieges, setzt dann der
amtliche Schriftverkehr ein, indem u.a. der Amtsschreiber von Meinersen an die
“Königliche Cammer“ nach Hannover berichtet, dass seit Menschengedenken
keine neuen Kuhlen angelegt worden sind. Somit kann man die Grabung der ersten
Teerkuhle in die Zeit zurückverlegen, bevor Kolumbus sich zur Fahrt nach Indien
rüstete und dabei Amerika entdeckte.
Das Gebiet um das spätere Oelheim, das als Wildnis bezeichnet wurde, gehörte
dem Staat, d. h. dem Königreich Hannover. Schon früh erkannte der Fiskus den
Wert den alle Bodenschätze mit sich brachten und sicherte sie sich als
Eigentum.
Diese Weidefläche wurde an die Gemeinden Edemissen und Oedesse als
Gemeinheitshude (=Weide) abgegeben. Edemissen und Oedesse stoßen mit ihren
Gemarkungsgrenzen hier zusammen. Die Teerkuhlen, die in dieser Fläche lagen,
wurden von der “Königlichen Cammer“ an Pächter gegen einen jährlichen
“Grundherrlichen Theerkuhlenzins“ von 2 Reichsthalern 9 Mariengroschen
verpachtet.
Die Gewinnung des Bergteers wurde auf die einfachste und primitivste Art ausgeübt,
wie sie schon bei den Ureinwohnern Amerikas von jeher gebräuchlich war. Um eine
recht große Ausbeute zu erlangen, wurden rechteckige Gruben verschiedener
Abmessungen gegraben. Da die Bearbeitung einer Grube ziemliche Körperkräfte
verlangte, richtete sich die Größe einer Grube nach der Konstitution des Pächters.
Insgesamt waren 18 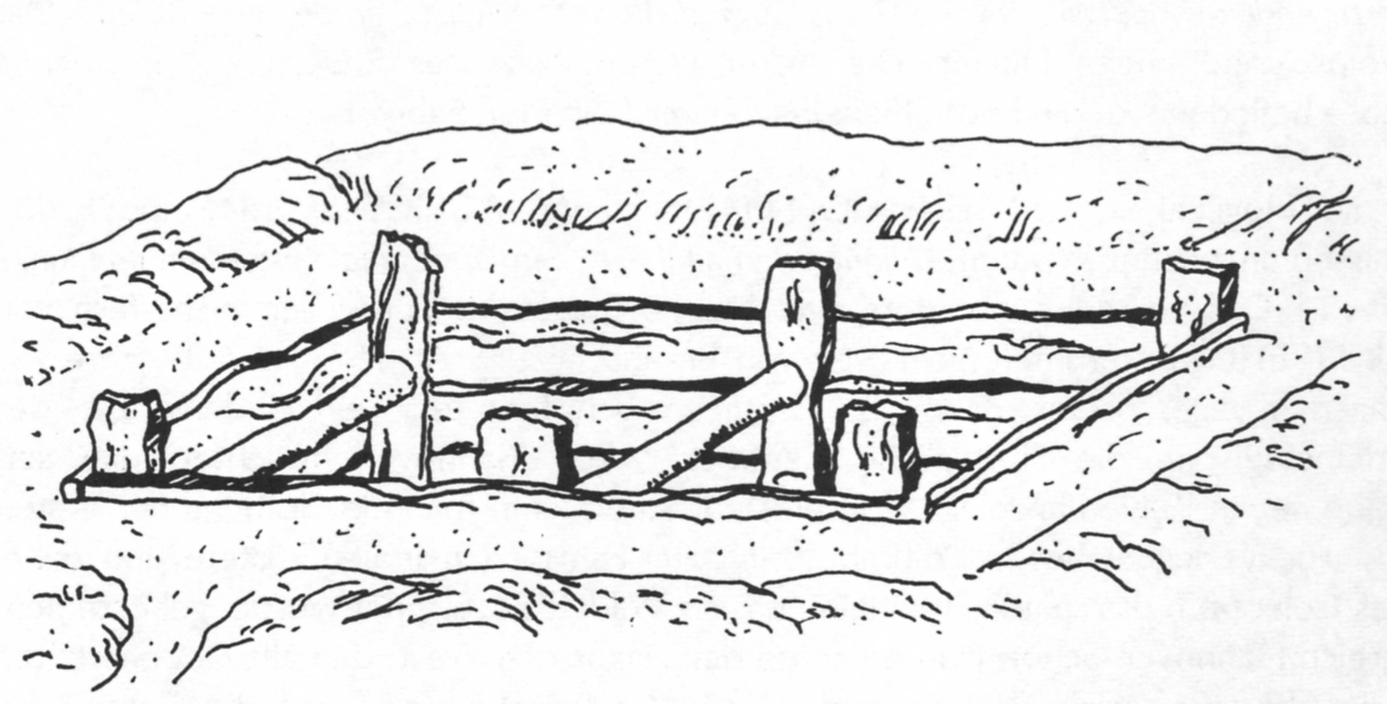 Kuhlen
angelegt, davon lagen auf Edemissener Gebiet 14 und die restlichen 4 auf
Oedesser Gemarkung. Das Schwarzwasser und ein kleiner Graben, die die Grenze
zwischen Edemissen und Oedesse bildeten, trennten gleichzeitig auch die
Teerkuhlen in zwei Bereiche. Die Edemissener Kuhlen waren im Allgemeinen kleiner
als die Oedesser. Sie hatten die Abmessungen von 3 mal 1,80 Meter. Da die Kuhlen
in der Landschaft etwas höher lagen, waren sie rund 3,60 Meter tief, um genügend
Wassertiefe zu erreichen. Die Oedesser Kuhlen mit 7,50 mal 3 Meter waren
bedeutend größer. Ihre Tiefe lag dagegen bei nur 1,80 Meter. Alle Kuhlen waren
am oberen Rand mit dicken Bohlen verschalt, damit das wenig feste Erdreich nicht
in die Grube fallen konnte. Die tiefen Edemissener Kuhlen hatten eine zusätzliche
Verschalung bis auf den Grund. Außerdem waren Steigeisen zum Besteigen
angebracht. Das zur Verschalung benötigte Holz stellte die Regierung
forstzinsfrei zur Verfügung, um sich eine stete Einnahmequelle für den
Staatshaushalt zu sichern. Meist vererbte sich die Pacht einer Kuhle vom Vater
auf den Sohn, da eine gewisse Technik beim Schöpfen erworben werden musste, die
sich mitvererbte, und die der späteren Ausbeute zugute kam.
Kuhlen
angelegt, davon lagen auf Edemissener Gebiet 14 und die restlichen 4 auf
Oedesser Gemarkung. Das Schwarzwasser und ein kleiner Graben, die die Grenze
zwischen Edemissen und Oedesse bildeten, trennten gleichzeitig auch die
Teerkuhlen in zwei Bereiche. Die Edemissener Kuhlen waren im Allgemeinen kleiner
als die Oedesser. Sie hatten die Abmessungen von 3 mal 1,80 Meter. Da die Kuhlen
in der Landschaft etwas höher lagen, waren sie rund 3,60 Meter tief, um genügend
Wassertiefe zu erreichen. Die Oedesser Kuhlen mit 7,50 mal 3 Meter waren
bedeutend größer. Ihre Tiefe lag dagegen bei nur 1,80 Meter. Alle Kuhlen waren
am oberen Rand mit dicken Bohlen verschalt, damit das wenig feste Erdreich nicht
in die Grube fallen konnte. Die tiefen Edemissener Kuhlen hatten eine zusätzliche
Verschalung bis auf den Grund. Außerdem waren Steigeisen zum Besteigen
angebracht. Das zur Verschalung benötigte Holz stellte die Regierung
forstzinsfrei zur Verfügung, um sich eine stete Einnahmequelle für den
Staatshaushalt zu sichern. Meist vererbte sich die Pacht einer Kuhle vom Vater
auf den Sohn, da eine gewisse Technik beim Schöpfen erworben werden musste, die
sich mitvererbte, und die der späteren Ausbeute zugute kam.
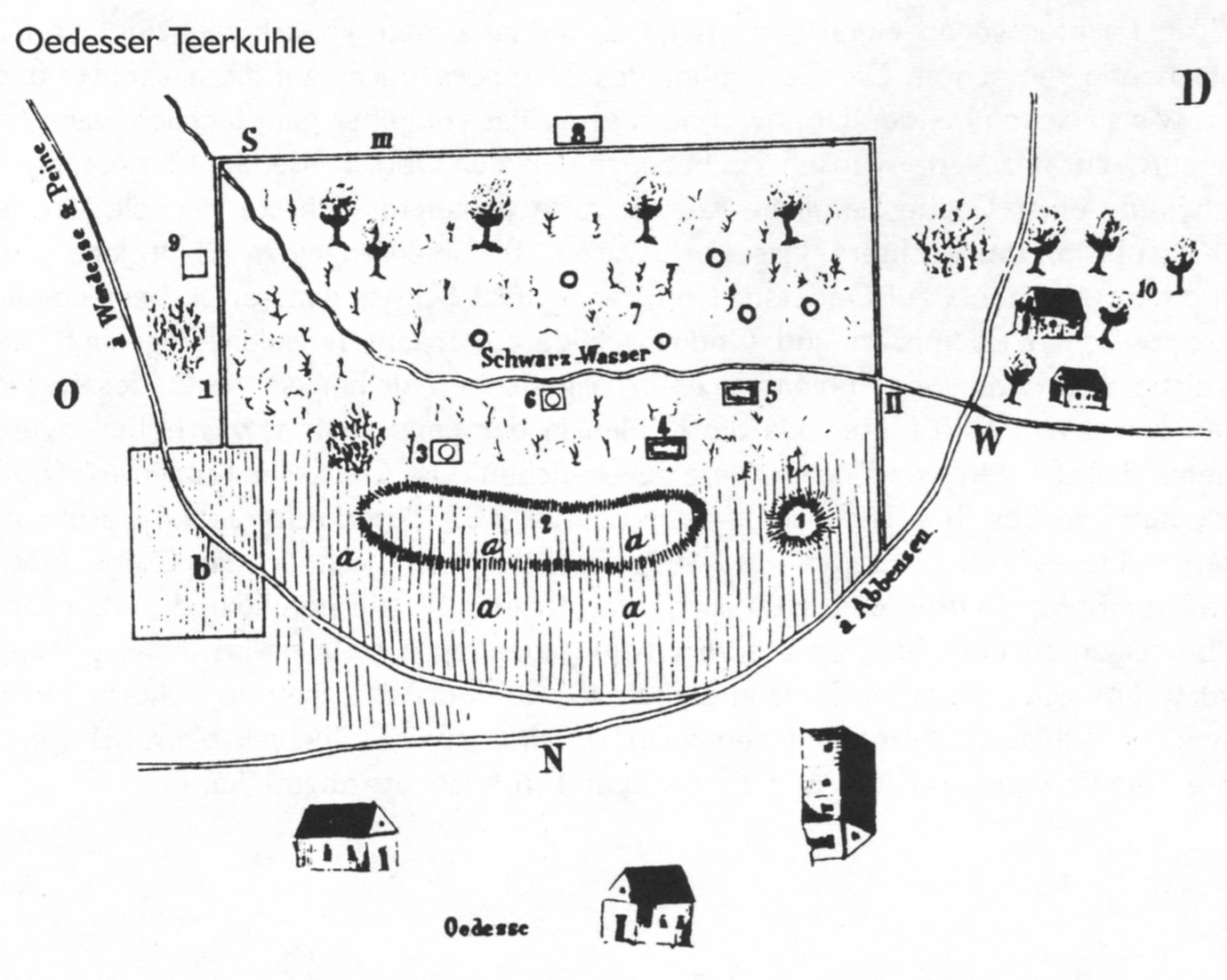 Jede
dieser Gruben wurde bei Tagesanbruch und nachmittags 2 Uhr vom Wasser leer geschöpft.
Bei der Wassermenge von 17 bzw. 40 cbm war dies wahrhaftig keine leichte Arbeit
und dabei standen zum Teil noch mehrere Kuhlen in Pacht. Zum Ausschöpfen des
Wassers bediente man sich hölzerner “Rohenäppe“ (=Rodenäpfe), das waren
Schöpfkellen an langen Stangen, die etwa 3 Liter fassten. Die Edemissener Pächter
waren etwas schlechter dran, weil sie bei der großen Tiefe in zwei Etagen schöpfen
mussten. Nachdem eine Teerkuhle vollständig vom Wasser entleert war, lief das
Wasser wieder von allen Seiten aus dem Erdreich zu und brachte das Öl aus dem
öldurchtränkten Boden mit, welches sich dann auf der Wasseroberfläche
ansammelte. Mit einem Risch (das sind geklopfte Binsen, die an einer langen
Stange gebunden wie ein Pferdeschweif aussahen), wurde die Wasseroberfläche
“awweflötet“ (abgefischt). Das Erdöl setzte sich an den aufgerissenen
Binsen fest und wurde mit der Hand in einen danebenstehenden hölzernen Eimer
abgestreift; an dessen Boden sich ein kleiner Hahn zum Ablassen des Wassers
befand. Die Prozedur wurde solange wiederholt, bis alles Fett von der Oberfläche
entfernt war. Bei all diesen Arbeiten blieb es nicht aus, dass man mit dem
Wasser in Berührung kam. Vielleicht hatte sich der eine oder andere
Verletzungen zugezogen oder andere Krankheiten wie Rheuma etc.‚ die durch das
Wasser dann schneller ausheilten als gewöhnlich. Da die Menschen früher der
Natur mehr verbunden waren als heute, ist die Beobachtung an den Teerkuhlen und
der Natur sicher intensiv gewesen. Etliche dieser mit der Natur im Zusammenhang
stehenden Phänomene sind uns von den Edemissener Pastoren PAPE und BARKHAUSEN
überliefert.
Jede
dieser Gruben wurde bei Tagesanbruch und nachmittags 2 Uhr vom Wasser leer geschöpft.
Bei der Wassermenge von 17 bzw. 40 cbm war dies wahrhaftig keine leichte Arbeit
und dabei standen zum Teil noch mehrere Kuhlen in Pacht. Zum Ausschöpfen des
Wassers bediente man sich hölzerner “Rohenäppe“ (=Rodenäpfe), das waren
Schöpfkellen an langen Stangen, die etwa 3 Liter fassten. Die Edemissener Pächter
waren etwas schlechter dran, weil sie bei der großen Tiefe in zwei Etagen schöpfen
mussten. Nachdem eine Teerkuhle vollständig vom Wasser entleert war, lief das
Wasser wieder von allen Seiten aus dem Erdreich zu und brachte das Öl aus dem
öldurchtränkten Boden mit, welches sich dann auf der Wasseroberfläche
ansammelte. Mit einem Risch (das sind geklopfte Binsen, die an einer langen
Stange gebunden wie ein Pferdeschweif aussahen), wurde die Wasseroberfläche
“awweflötet“ (abgefischt). Das Erdöl setzte sich an den aufgerissenen
Binsen fest und wurde mit der Hand in einen danebenstehenden hölzernen Eimer
abgestreift; an dessen Boden sich ein kleiner Hahn zum Ablassen des Wassers
befand. Die Prozedur wurde solange wiederholt, bis alles Fett von der Oberfläche
entfernt war. Bei all diesen Arbeiten blieb es nicht aus, dass man mit dem
Wasser in Berührung kam. Vielleicht hatte sich der eine oder andere
Verletzungen zugezogen oder andere Krankheiten wie Rheuma etc.‚ die durch das
Wasser dann schneller ausheilten als gewöhnlich. Da die Menschen früher der
Natur mehr verbunden waren als heute, ist die Beobachtung an den Teerkuhlen und
der Natur sicher intensiv gewesen. Etliche dieser mit der Natur im Zusammenhang
stehenden Phänomene sind uns von den Edemissener Pastoren PAPE und BARKHAUSEN
überliefert.
